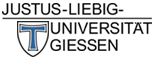Joint project
SPP 1392 TP - Integrative analysis of olfaction
Funder: German Research Foundation
Period: 2009-2016
URI: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/122735975
Detailed description:
Der Geruchssinn ist der evolutionär älteste Sinn im Tierreich. Riechen ist für unser Wohlbefinden wichtig, selbst wenn uns seine Bedeutung bei der bewussten Wahrnehmung der Umwelt oft nicht so groß erscheint. Während Antwortspektren und Transduktionsmechanismen der Rezeptoren zunehmend bekannt sind, bleibt der Duftsinn insgesamt der am wenigsten verstandene aller Sinne. Dies mag an der intrinsischen Komplexität dieses Systems liegen: Es gibt Hunderte unterschiedlicher Rezeptorfamilien, die mit flüchtigen Substanzen in der Umwelt interagieren, und die hierbei gewonnene Information wird in hochstrukturierten Gehirnarealen verarbeitet, erst im olfaktorischen Bulbus, dann im Kortex (oder ihren analogen Strukturen).
Es gilt, etliche grundsätzliche Fragen zu klären: Wie entsteht aus einer bestimmten Mischung flüchtiger Substanzen das charakteristische raum-zeitliche Aktivitätsmuster im Gehirn und wie entsteht aus diesem Muster ein perzeptiver Eindruck, der schließlich ein Verhalten auslöst? Wie ist ein Perzept repräsentiert? Wie funktioniert das olfaktorische Gedächtnis und wo ist es zu lokalisieren? Welche Mechanismen erzeugen die Duftwirkung auf Emotionen und auf das Verhalten? Dies sind die wichtigen Fragen, die in den Neurowissenschaften in den nächsten Jahren gestellt werden, und dies ist die Herausforderung, der sich dieses Schwerpunktprogramm stellt. Sein Ziel ist es, die Olfaktorik in ihrer Gesamtheit zu verstehen, indem die verschiedenen Verarbeitungsstufen (weiter) erforscht werden: (1) Signalkaskaden und Kodierung, (2) Informationsverarbeitung, (3) Sensorische Leistungen und Verhalten sowie (4) Perzeption und Kognition.
Das Schwerpunktprogramm ist ein interdisziplinäres Projekt, das aus 16 Kooperationsarbeitsgruppen besteht. Jede Arbeitsgruppe umfasst mindestens zwei Fachrichtungen mit unterschiedlichem disziplinärem Hintergrund. Die dabei beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwerben ein breites, interdisziplinäres Wissen, das eine gute Grundlage für den Arbeitsmarkt sein wird.
Teilprojekt:
The vertebrate olfactory sense consists of several subsystems, which are anatomically separated in mammals. These subsystems traditionally were assumed to mediate segregated functions: the main olfactory epithelium containing ciliated olfactory receptor neurons was supposed to mediate food detection, whereas the vomeronasal organ containing two classes of microvillous receptor neurons was believed to mediate pheromone detection (note that the current picture is more complex). In fishes the corresponding cell types and homologous olfactory receptor families are present, however all are intermingled in a single olfactory epithelium. Fish olfactory receptor repertoires show marked similarities, but also distinctly different properties compared to their mammalian homologs. Large differences in function are expected and have been partially demonstrated. So far it is completely unclear, how the shift in organization and function of the olfactory system occurred. Amphibians represent an evolutionary intermediary between fishes and mammalian species with respect to life style (partially aquatic), anatomical specialisation (separate vomeronasal organ), and evolution of olfactory receptor gene families. We will combine advanced physiological and molecular biological approaches to deorphanize olfactory receptor neurons and olfactory receptor genes in the clawed frog, Xenopus lavis.
Der Geruchssinn ist der evolutionär älteste Sinn im Tierreich. Riechen ist für unser Wohlbefinden wichtig, selbst wenn uns seine Bedeutung bei der bewussten Wahrnehmung der Umwelt oft nicht so groß erscheint. Während Antwortspektren und Transduktionsmechanismen der Rezeptoren zunehmend bekannt sind, bleibt der Duftsinn insgesamt der am wenigsten verstandene aller Sinne. Dies mag an der intrinsischen Komplexität dieses Systems liegen: Es gibt Hunderte unterschiedlicher Rezeptorfamilien, die mit flüchtigen Substanzen in der Umwelt interagieren, und die hierbei gewonnene Information wird in hochstrukturierten Gehirnarealen verarbeitet, erst im olfaktorischen Bulbus, dann im Kortex (oder ihren analogen Strukturen).
Es gilt, etliche grundsätzliche Fragen zu klären: Wie entsteht aus einer bestimmten Mischung flüchtiger Substanzen das charakteristische raum-zeitliche Aktivitätsmuster im Gehirn und wie entsteht aus diesem Muster ein perzeptiver Eindruck, der schließlich ein Verhalten auslöst? Wie ist ein Perzept repräsentiert? Wie funktioniert das olfaktorische Gedächtnis und wo ist es zu lokalisieren? Welche Mechanismen erzeugen die Duftwirkung auf Emotionen und auf das Verhalten? Dies sind die wichtigen Fragen, die in den Neurowissenschaften in den nächsten Jahren gestellt werden, und dies ist die Herausforderung, der sich dieses Schwerpunktprogramm stellt. Sein Ziel ist es, die Olfaktorik in ihrer Gesamtheit zu verstehen, indem die verschiedenen Verarbeitungsstufen (weiter) erforscht werden: (1) Signalkaskaden und Kodierung, (2) Informationsverarbeitung, (3) Sensorische Leistungen und Verhalten sowie (4) Perzeption und Kognition.
Das Schwerpunktprogramm ist ein interdisziplinäres Projekt, das aus 16 Kooperationsarbeitsgruppen besteht. Jede Arbeitsgruppe umfasst mindestens zwei Fachrichtungen mit unterschiedlichem disziplinärem Hintergrund. Die dabei beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erwerben ein breites, interdisziplinäres Wissen, das eine gute Grundlage für den Arbeitsmarkt sein wird.
Teilprojekt:
The vertebrate olfactory sense consists of several subsystems, which are anatomically separated in mammals. These subsystems traditionally were assumed to mediate segregated functions: the main olfactory epithelium containing ciliated olfactory receptor neurons was supposed to mediate food detection, whereas the vomeronasal organ containing two classes of microvillous receptor neurons was believed to mediate pheromone detection (note that the current picture is more complex). In fishes the corresponding cell types and homologous olfactory receptor families are present, however all are intermingled in a single olfactory epithelium. Fish olfactory receptor repertoires show marked similarities, but also distinctly different properties compared to their mammalian homologs. Large differences in function are expected and have been partially demonstrated. So far it is completely unclear, how the shift in organization and function of the olfactory system occurred. Amphibians represent an evolutionary intermediary between fishes and mammalian species with respect to life style (partially aquatic), anatomical specialisation (separate vomeronasal organ), and evolution of olfactory receptor gene families. We will combine advanced physiological and molecular biological approaches to deorphanize olfactory receptor neurons and olfactory receptor genes in the clawed frog, Xenopus lavis.
Coordinating organisation / Consortium Leader
- University of Konstanz
Cooperation partners with funding
- University of Kassel
- Max Planck Institute for Chemical Ecology
- Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur
- University of Göttingen
- Ruhr University Bochum