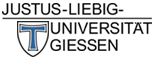Joint project
SPP 1596 TP - Ökologie und Speziesbarrieren bei neuartigen Viruserkrankungen - Teilprojekt: Antiviral aktive Faktoren der Typ I-Interferonsysteme kleiner Säugetiere
Funder: German Research Foundation
Period: 2015-2018
URI: https://gepris.dfg.de/gepris/projekt/226373496
Detailed description:
Das Arbeitsfeld "Neuartige Viruserkrankungen" genießt derzeit ein hohes öffentliches Interesse. Die große Vielfalt der beforschten Erreger und die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit stellen auf diesem neuen Gebiet eine besondere Herausforderung dar. In den vergangenen Jahren wurde der Nutzen einer verstärkten Kooperation zwischen Human- und Veterinärmedizin klar erkannt. Dieser "One Health"-Ansatz löst aber nur einen Teil des Problems, denn die medizinische Perspektive ist für ein grundlegendes Verständnis zu eng. Bisher gibt es wenig Zusammenarbeit zwischen den Grundlagendisziplinen Virologie und Zoologie/Ökologie. Zwar interessieren sich beide Felder für Pathogenentstehung und Evolution, aber es gibt eine klaffende Lücke in den verwendeten Methoden, den Fragestellungen und teilweise sogar in der Terminologie. Für die Medizin sollen die Projekte in diesem Schwerpunktprogramm das Verständnis von Erreger-Evolution und Epidemie-Entstehung verbessern. Durch neue Daten zu natürlichen Virus-Wirt-Interaktionen hoffen wir außerdem, neue Infektionsmodelle zu entdecken und in unserem Verständnis menschlicher Infektionsvorgänge weiterzukommen. Im Feld der Zoologie/Ökologie soll die Verfügbarkeit von Viren und deren schneller Evolution als neuer Parameter Zusammenhänge erschließen, die an langsam evolvierenden Modellen vielleicht nicht sichtbar werden. Das Schwerpunktprogramm vereint insbesondere solche Arbeitsgruppen, die über eine rein medizinische Anwendung hinaus ein grundlegendes Interesse an Virus-Wirt-Interaktionen haben. Das Arbeitsspektrum reicht dabei von Studien zu Habitatnutzung und Life History Traits, immunbiologischen Vergleichsuntersuchungen, bis hin zur Charakterisierung von Wirtsrestriktionen im viralen Vermehrungszyklus. Ein gemeinsames übergeordnetes Ziel liegt in der inhaltlichen Belebung des bisher abstrakten Begriffs der "Artenbarriere".
Teilprojekt:
The interferon system of mammals represents an important species barrier against invading viruses. Immediately after infection, cells synthesize and secrete type I interferons (IFN-alpha/beta) which bind to their receptor on surrounding cells. This leads to the expression of more than 300 IFN-stimulated genes (ISGs). Several ISG products, among them the so-called Mx proteins, possess antiviral properties, thus controlling intracellular viral replication and spread. It is known that ISGs from different species can have varying antiviral properties. The murine Mx1, for example, specifically inhibits influenza viruses, whereas human MxA targets a broad spectrum of RNA and some DNA viruses. The goal of this project is to characterize the components of the IFN system of bats. Bats are an important zoonotic reservoir. Viruses which are highly virulent for humans can be persistent and asymptomatic in bats. Although it could be key for understanding the differences in virus susceptibility, the IFN system of bats has remained largely uncharacterized. Here, we will investigate the expression of IFN in virus-infected cells from various bat species. Furthermore, we plan to perform a genome-wide transcriptome analysis of virus-infected and IFN-treated cells of a selected bat species, Myotis daubentonii. Candidates for bat ISGs will be cloned and tested for their antiviral activity against a range of viruses. The antiviral Mx protein family will be analyzed in cells covering all bat families in order to analyse co-evolution of the bat IFN system with circulating viruses. Altogether, it is possible that bats possess a special IFN system that allows them to better cope with different kinds of viruses. On the other hand, similarities between the IFN systems of humans and bats could facilitate zoonotic virus transmission between the species without adaptations. The proposed project is aimed at getting first insights into the molecular specialities of the bat antiviral, innate immune response.
Das Arbeitsfeld "Neuartige Viruserkrankungen" genießt derzeit ein hohes öffentliches Interesse. Die große Vielfalt der beforschten Erreger und die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit stellen auf diesem neuen Gebiet eine besondere Herausforderung dar. In den vergangenen Jahren wurde der Nutzen einer verstärkten Kooperation zwischen Human- und Veterinärmedizin klar erkannt. Dieser "One Health"-Ansatz löst aber nur einen Teil des Problems, denn die medizinische Perspektive ist für ein grundlegendes Verständnis zu eng. Bisher gibt es wenig Zusammenarbeit zwischen den Grundlagendisziplinen Virologie und Zoologie/Ökologie. Zwar interessieren sich beide Felder für Pathogenentstehung und Evolution, aber es gibt eine klaffende Lücke in den verwendeten Methoden, den Fragestellungen und teilweise sogar in der Terminologie. Für die Medizin sollen die Projekte in diesem Schwerpunktprogramm das Verständnis von Erreger-Evolution und Epidemie-Entstehung verbessern. Durch neue Daten zu natürlichen Virus-Wirt-Interaktionen hoffen wir außerdem, neue Infektionsmodelle zu entdecken und in unserem Verständnis menschlicher Infektionsvorgänge weiterzukommen. Im Feld der Zoologie/Ökologie soll die Verfügbarkeit von Viren und deren schneller Evolution als neuer Parameter Zusammenhänge erschließen, die an langsam evolvierenden Modellen vielleicht nicht sichtbar werden. Das Schwerpunktprogramm vereint insbesondere solche Arbeitsgruppen, die über eine rein medizinische Anwendung hinaus ein grundlegendes Interesse an Virus-Wirt-Interaktionen haben. Das Arbeitsspektrum reicht dabei von Studien zu Habitatnutzung und Life History Traits, immunbiologischen Vergleichsuntersuchungen, bis hin zur Charakterisierung von Wirtsrestriktionen im viralen Vermehrungszyklus. Ein gemeinsames übergeordnetes Ziel liegt in der inhaltlichen Belebung des bisher abstrakten Begriffs der "Artenbarriere".
Teilprojekt:
The interferon system of mammals represents an important species barrier against invading viruses. Immediately after infection, cells synthesize and secrete type I interferons (IFN-alpha/beta) which bind to their receptor on surrounding cells. This leads to the expression of more than 300 IFN-stimulated genes (ISGs). Several ISG products, among them the so-called Mx proteins, possess antiviral properties, thus controlling intracellular viral replication and spread. It is known that ISGs from different species can have varying antiviral properties. The murine Mx1, for example, specifically inhibits influenza viruses, whereas human MxA targets a broad spectrum of RNA and some DNA viruses. The goal of this project is to characterize the components of the IFN system of bats. Bats are an important zoonotic reservoir. Viruses which are highly virulent for humans can be persistent and asymptomatic in bats. Although it could be key for understanding the differences in virus susceptibility, the IFN system of bats has remained largely uncharacterized. Here, we will investigate the expression of IFN in virus-infected cells from various bat species. Furthermore, we plan to perform a genome-wide transcriptome analysis of virus-infected and IFN-treated cells of a selected bat species, Myotis daubentonii. Candidates for bat ISGs will be cloned and tested for their antiviral activity against a range of viruses. The antiviral Mx protein family will be analyzed in cells covering all bat families in order to analyse co-evolution of the bat IFN system with circulating viruses. Altogether, it is possible that bats possess a special IFN system that allows them to better cope with different kinds of viruses. On the other hand, similarities between the IFN systems of humans and bats could facilitate zoonotic virus transmission between the species without adaptations. The proposed project is aimed at getting first insights into the molecular specialities of the bat antiviral, innate immune response.
Coordinating organisation / Consortium Leader
- Charité - Universitätsmedizin Berlin
Cooperation partners with funding
- University Medical Center Freiburg
- University of Giessen
- University of Antwerp
- Friedrich-Loeffler-Institut
- Freie Universität Berlin