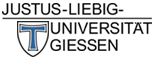Joint project
BoTaRem - Enzymatischer Abbau von Ebergeruch-Substanzen während der Herstellung von Fleischprodukten
Funder: Federal Ministry of Food and Agriculture
Period: 2019-2023
Detailed description:
FORSCHUNGSZIEL: Durch den Einsatz geeigneter Enzymmischungen aus Speisepilzen (Ständerpilze, Basidiomyceten) sollen Ebergeruch produzierende Substanzen in Schweinefleisch dahingehend modifiziert werden, dass kein Ebergeruch mehr auftritt. Durch ein solch innovatives Verfahren könnte ebergeruchbelastetes Schweinefleisch vollständig und wertschöpfend zu sensorisch akzeptierten Brühwürsten verarbeitet werden. Damit würde die Auslobung höherer Tierwohl-Standards für Fleischerzeugnisse möglich, da eine Ferkelkastration zur Unterdrückung des Ebergeruches nicht notwendig wäre.
AUSGANGSSITUATION UND PROBLEMSTELLUNG: Das Fleisch von männlichen Schweinen kann einen unangenehmen Geruch aufweisen, der von einer hohen Anzahl in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Die Auswirkungen durch ebergeruchbelastetes Schweinefleisch sind in der gesamten Produktionskette relevant. Diese beginnt bei den Ferkelerzeugern und verläuft über die Schweinemäster zu den Schlachtunternehmen. Um Ebergeruch bei Fleischprodukten zu verhindern, werden in Deutschland nahezu alle Ferkel betäubungslos kastriert. Diese Vorgehensweise ist aus Gründen des Tierwohls umstritten und zukünftig darf eine Kastration nur noch unter Betäubung des Tieres durchgeführt werden. Jedoch geht der wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in seinen Leitlinien für eine gesellschaftlich akzeptierte Nutztierhaltung noch weiter, denn diese beinhaltet u. a. den kompletten Verzicht auf Amputationen, wie sie z. B. bei der Ferkelkastration durchgeführt werden. Das anstehende Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration wurde 2019 um zwei Jahre auf den 01.01.2021 verschoben. Obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist, gibt es in der Praxis noch große Probleme bei der Einführung alternativer Verfahren. Aktuell sind drei Alternativen möglich: Die (Jung-) Ebermast, die Immunokastration und die Kastration unter allgemeiner Betäubung. Es wird auch als vierte Möglichkeit die Kastration durch den Landwirt nach lokaler Betäubung diskutiert. Studien gehen davon aus, dass alle drei Alternativen mit unterschiedlicher Häufigkeit je nach Region in Deutschland angewendet werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es insgesamt zu einem vergleichsweise erhöhten Auftreten von ebergeruchbelastetem Fleisch kommen - zu den Ebern aus der (Jung) Ebermast kommen noch die Impfversager aus der Immunokastration.
LÖSUNGSWEG: Zum Erreichen des Forschungsziels kooperiert das MRI mit den Universitäten Gießen und Göttingen in drei Teilprojekten: 1. Technologie und chemische Analytik (Forschungsstelle 1: Max Rubner-Insitut (MRI-FL), Kulmbach, Projekt-Koordination) Herstellung der Fleischprodukte und Anpassung der Rezeptur an die Erfordernisse der Enzymmischungen aus Speisepilzen (Ständerpilze, Basidiomyceten). Hierbei werden die Interaktionen (z.B. synergistische Effekte) der für den Ebergeruch verantwortlichen Substanzen (Androstenon, 3/-Androstenol, Skatol, Indol, 2-Aminoacetophenon) analysiert. Zum Einsatz kommen Methoden der Hochleistungsflüssigkeits-chromatographie in Kombination mit spektroskopischen Detektionsmethoden (HPLC-FD, HPLC-UV/VIS) und Massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS). Mögliche Veränderungen anderer Metaboliten aufgrund des Einsatzes von neuartigen, innovativen Enzyme werden mittels ungerichteter Analyse (Metabolomics) erfasst. 2. Isolation, Charakterisierung und Bereitstellung von Enzymen (Forschungsstelle 2: Justus-Liebig-Universität (LCB), Gießen): Geeignete, innovative Enzyme aus den Speisepilzen sollen für den Abbau der Ebergeruch-Substanzen im großen Maßstab präpariert, isoliert und biochemisch sowie molekularbiologisch charakterisiert werden. Bereits in Vorversuchen konnte in Modellsystemen die Wirksamkeit einzelner Pilze nachgewiesen werden. Olfaktometrische Gaschromatographie gekoppelt mit Massenspektrometrischer Detektion (GC-MS-O) dient der Verifizierung des Abbaus der geru
FORSCHUNGSZIEL: Durch den Einsatz geeigneter Enzymmischungen aus Speisepilzen (Ständerpilze, Basidiomyceten) sollen Ebergeruch produzierende Substanzen in Schweinefleisch dahingehend modifiziert werden, dass kein Ebergeruch mehr auftritt. Durch ein solch innovatives Verfahren könnte ebergeruchbelastetes Schweinefleisch vollständig und wertschöpfend zu sensorisch akzeptierten Brühwürsten verarbeitet werden. Damit würde die Auslobung höherer Tierwohl-Standards für Fleischerzeugnisse möglich, da eine Ferkelkastration zur Unterdrückung des Ebergeruches nicht notwendig wäre.
AUSGANGSSITUATION UND PROBLEMSTELLUNG: Das Fleisch von männlichen Schweinen kann einen unangenehmen Geruch aufweisen, der von einer hohen Anzahl in der Bevölkerung wahrgenommen wird. Die Auswirkungen durch ebergeruchbelastetes Schweinefleisch sind in der gesamten Produktionskette relevant. Diese beginnt bei den Ferkelerzeugern und verläuft über die Schweinemäster zu den Schlachtunternehmen. Um Ebergeruch bei Fleischprodukten zu verhindern, werden in Deutschland nahezu alle Ferkel betäubungslos kastriert. Diese Vorgehensweise ist aus Gründen des Tierwohls umstritten und zukünftig darf eine Kastration nur noch unter Betäubung des Tieres durchgeführt werden. Jedoch geht der wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft in seinen Leitlinien für eine gesellschaftlich akzeptierte Nutztierhaltung noch weiter, denn diese beinhaltet u. a. den kompletten Verzicht auf Amputationen, wie sie z. B. bei der Ferkelkastration durchgeführt werden. Das anstehende Verbot der betäubungslosen Ferkelkastration wurde 2019 um zwei Jahre auf den 01.01.2021 verschoben. Obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist, gibt es in der Praxis noch große Probleme bei der Einführung alternativer Verfahren. Aktuell sind drei Alternativen möglich: Die (Jung-) Ebermast, die Immunokastration und die Kastration unter allgemeiner Betäubung. Es wird auch als vierte Möglichkeit die Kastration durch den Landwirt nach lokaler Betäubung diskutiert. Studien gehen davon aus, dass alle drei Alternativen mit unterschiedlicher Häufigkeit je nach Region in Deutschland angewendet werden. Mit hoher Wahrscheinlichkeit wird es insgesamt zu einem vergleichsweise erhöhten Auftreten von ebergeruchbelastetem Fleisch kommen - zu den Ebern aus der (Jung) Ebermast kommen noch die Impfversager aus der Immunokastration.
LÖSUNGSWEG: Zum Erreichen des Forschungsziels kooperiert das MRI mit den Universitäten Gießen und Göttingen in drei Teilprojekten: 1. Technologie und chemische Analytik (Forschungsstelle 1: Max Rubner-Insitut (MRI-FL), Kulmbach, Projekt-Koordination) Herstellung der Fleischprodukte und Anpassung der Rezeptur an die Erfordernisse der Enzymmischungen aus Speisepilzen (Ständerpilze, Basidiomyceten). Hierbei werden die Interaktionen (z.B. synergistische Effekte) der für den Ebergeruch verantwortlichen Substanzen (Androstenon, 3/-Androstenol, Skatol, Indol, 2-Aminoacetophenon) analysiert. Zum Einsatz kommen Methoden der Hochleistungsflüssigkeits-chromatographie in Kombination mit spektroskopischen Detektionsmethoden (HPLC-FD, HPLC-UV/VIS) und Massenspektrometrischer Detektion (HPLC-MS/MS). Mögliche Veränderungen anderer Metaboliten aufgrund des Einsatzes von neuartigen, innovativen Enzyme werden mittels ungerichteter Analyse (Metabolomics) erfasst. 2. Isolation, Charakterisierung und Bereitstellung von Enzymen (Forschungsstelle 2: Justus-Liebig-Universität (LCB), Gießen): Geeignete, innovative Enzyme aus den Speisepilzen sollen für den Abbau der Ebergeruch-Substanzen im großen Maßstab präpariert, isoliert und biochemisch sowie molekularbiologisch charakterisiert werden. Bereits in Vorversuchen konnte in Modellsystemen die Wirksamkeit einzelner Pilze nachgewiesen werden. Olfaktometrische Gaschromatographie gekoppelt mit Massenspektrometrischer Detektion (GC-MS-O) dient der Verifizierung des Abbaus der geru
Coordinating organisation / Consortium Leader
- Research Association of the German Food Industry
Cooperation partners with funding
- University of Giessen
- University of Göttingen
Associated partners
- Bundesverband Deutscher Wurst- & Schinkenproduzenten e.V.
- Deutscher Bauernverband e.V.
- Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft e.V.