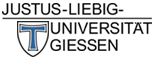Working paper/research report
Authors list: Breitmeier, H
Editor list: Deutsche Stiftung für Friedensforschung, (DSF)
Publication year: 2009
Title of series: Forschung / DSF
Number in series: 17
Abstract:
Die Berichte der Klimaforschung deuten mit immer größerer Sicherheit darauf hin, dass der anthropogene Klimawandel in den nächsten Jahrzehnten zu weit reichenden Umweltveränderungen führen wird. Die Wirkungen des Klimawandels und dessen Nebeneffekte (z.B. Meeresspiegelanstieg, extreme Wetterereignisse, Wassermangel und Dürre, Mangel an Nahrungsmitteln, Migration) werden die sozio-ökonomischen Lebensbedingungen möglicherweise so tiefgreifend verändern, dass innerhalb und jenseits der Grenzen des Nationalstaates die Entstehung neuer Konflikte droht und sich die Intensität vorhandener Konflikte verschärft. Die Folgen des Klimawandels entfalten sich besonders in Entwicklungs- und Schwellenländern, die fragile politische und gesellschaftliche Strukturen aufweisen und in denen die Kapazitäten zur Gewaltprävention häufig schwach ausgebildet sind. Für die Friedens- und Konfliktforschung ergibt sich die Aufgabe, die zukünftigen Konflikte und die davon betroffenen Länder und Gebiete zu identifizieren und Strategien für eine friedliche Konfliktbearbeitung zu entwickeln. Der Beitrag von Umweltveränderungen zum gewaltsamen Konfliktaustrag wurde in den vergangenen beiden Jahrzehnten innerhalb des Forschungsprogramms zur „ökologischen Sicherheit“ erforscht. Diese Studien stellen einen wichtigen theoretisch-konzeptionellen Ausgangspunkt für die weitere Erforschung der Problematik dar. Eine Bestandsaufnahme der empirischen und kausalanalytischen Befunde der Forschungen zur „ökologischen Sicherheit“ und der daran geäußerten Kritik zeigt, dass Umweltveränderungen nicht zwangsläufig zum gewaltsamen Konfliktaustrag führen.
In vielen Fällen wurden grenzüberschreitende und innerstaatliche Konflikte über knappe Ressourcen (z.B. Wasser) innerhalb von Institutionen friedlich bearbeitet. Umweltzerstörung und Ressourcenknappheit wirkten andererseits dann als indirekte Ursache für den gewaltsamen Konfliktaustrag, wenn sich die Intensität des Umwelt- und Ressourcenkonflikts durch ungerechte Besitzverhältnisse, einen Herrschaftskonflikt und fehlende Mechanismen zur Konfliktbearbeitung verschärfte oder wenn ein Umwelt- und Ressourcenkonflikt als Katalysator für bereits existierende Konflikte (z.B. ethnische Konflikte) diente. Für die Friedens- und Konfliktforschung stellen sich folgende Fragen: Welche Konflikte ergeben sich mit den sozio-ökonomischen Veränderungen, die durch den Klimawandel ausgelöst werden? Unter welchen Bedingungen werden diese Konflikte gewaltsam oder friedlich ausgetragen? Welche Möglichkeiten bestehen zur Anpassung an den Klimawandel und zur Gewaltprävention?
Konflikte um knapper werdendes Wasser und Nahrungsmittel werden sich besonders in Entwicklungsländern häufen. In diesen Ländern wird auch die klimainduzierte Migration besonders stark ausgeprägt sein. Neben einer Betrachtung von klimainduzierten Konflikten über sektorale Probleme (z.B. Wasser, Nahrungsmittel, Dürre) muss sich der Blick auch auf solche Konflikte richten, die aufgrund der besonderen geographischen Lage lokaler, regionaler oder nationaler Territorien entstehen oder die sich in spezifischen Siedlungsformen ergeben. Der starke Trend zur Urbanisierung und des Wachstums von Megastädten ist in den Entwicklungsländern von einer massiven Verelendung großer sozialer Gruppen in Slums begleitet. Dies gibt zur Befürchtung Anlass, dass die Umweltveränderungen in diesen Siedlungsräumen zu besonders heftigen sozialen Unruhen führen könnten. Urbane Ballungsräume befinden sich sehr häufig in Küstennähe und sind deshalb gegenüber extremen Wetterereignissen oder dem Anstieg des Meeresspiegels besonders verwundbar.
Für die Zukunft stellt sich die Aufgabe, Szenarien über den Einfluss der klimainduzierten Umweltveränderungen auf die sozio-ökonomischen Verhältnisse auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu entwickeln. Mit einer frühzeitigen Identifizierung solcher Krisenländer, -regionen und -städte kann die Friedens- und Konfliktforschung einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass in den betroffenen Gebieten rechtzeitig Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel und zur Gewaltprävention ergriffen werden. Für die Menschheit sind noch Optionen vorhanden, um das vielfach beschriebene Szenario abzuwenden, dass der Klimawandel zu neuen Gewaltkonflikten führen wird. Der Blick der Analyse muss verstärkt auf jene Bedingungen gerichtet werden, durch welche die Wirkungen des Klimawandels in den betroffenen Krisengebieten gemildert werden können und welche ein Umschlagen in den Gewaltkonflikt verhindern.
Citation Styles
Harvard Citation style: Breitmeier, H. (2009) Klimawandel und Gewaltkonflikte. (Forschung / DSF, 17). Osnabrück: Deutsche Stiftung für Friedensforschung (DSF)
APA Citation style: Breitmeier, H. (2009). Klimawandel und Gewaltkonflikte. (Forschung / DSF, 17). Deutsche Stiftung für Friedensforschung (DSF).